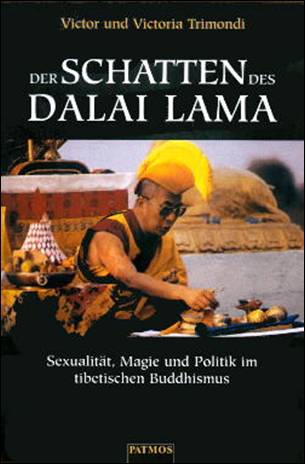|
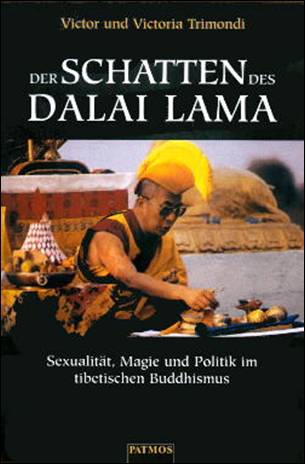
EXPOSÉ 2
INHALT
"Der Schatten des Dalai Lama"
POSTSCRIPTUM:
SCHÖPFERISCHE POLARITÄT JENSEITS DES TANTRISMUS
INHALT
Vorbemerkung: Licht
und Schatten
Teil I - Ritual als Politik
1 - Buddhismus und
Misogynie - ein historischer Überblick
Das "Opferung" der Maya: Die Buddhalegenden
Die meditative Zerstückelung der Frau: Der Hinayana
Buddhismus
Die Verwandlung der Frauen in Männer: Der Mahayana
Buddhismus
2 - Buddhistischer
Tantrismus: Das ritualisierte "Frauenopfer"
Die Explosion des Sexus: Der Vajrayana Buddhismus
Mystische Geschlechterliebe und kosmogonischer Eros
Der Guru als Manipulator des Göttlichen
Die Aneignung der Gynergie und androzentrische
Machtstrategien
Die absolute Macht des "Großmagiers" (Maha
Siddha)
Die drei Rollen der Sexualpartnerin im buddhistischen
Tantrismus
Das "tantrische Frauenopfer"
Das "Gesetz der Umkehrung"
Die Übereinstimmung mit dem Dämonischen
Reiner Shaktismus und tantrischer Feminismus
Das "alchemistische Frauenopfer"
3 - Das Kalachakra
Tantra: Die mikrokosmische Konstruktion eines Weltenherrschers
Die sieben unteren öffentlichen Einweihungen und ihre
Symboldeutung
Die vier höheren "geheimen" Einweihungen
Sperma und Menstruationsblut als magische Substanzen
Das "Ganachakra" und die vier
"höchsten" Einweihungen
Die inneren Vorgänge im mystischen Körper des Yogi
Die "Tropfentheorie" als Ausdruck der
Androgynität
Exkurs: Der mystische Körper der Frau
Die Methode oder die Manipulation des Göttlichen
4 - Der ADI BUDDHA:
Herr der Geschichte
Die "zehn Mächtigen": Der mystische Leib des
ADI BUDDHA
"Krieg der Sterne": Der astral-zeitliche
Aspekt des ADI BUDDHA
Das "Mandala Prinzip": Der
räumlich-kosmische Machtbereich des ADI BUDDHA
Der Weltenherrscher: Die politisch-soziale
Machtausübung des ADI BUDDHA
5 - Der aggressive
Mythos von Shambhala: Krieg zwischen Buddha und Allah
Die Könige und die Verwaltung von Shambhala
Der "rasende Raddreher": Die Kriegsideologie
von Shambhala
Tödliche Kriegsmaschinen
Die "Letzte Schlacht"
Buddha gegen Allah
Nichtbuddhistische Ursprünge des Shambhala Mythos
Shambhala "Innen" und Shambhala
"Außen"
6 - Zwei westliche
Zugänge zu den Ideen des Kalachakra Tantras
Das "tiefverruchte Buch": Albert Grünwedel
(Deutscher Orientalist und Übersetzer des Kalachakra Tantras)
Der Manipulator des Eros: Giordano Bruno
(Renaissancephilosoph)
7 - Epilog zum ersten Teil
Teil II - Politik als Ritual
1 - Der Dalai Lama:
Inkarnation der tibetischen Götter
Buddha Amitabha: Die Sonnen- und Lichtgottheit
Die verschiedenen Masken des Avalokiteshvara
Der XIV Dalai Lama als der Höchste Kalachakra -
Meister
Äußerungen des XIV Dalai Lama zur Sexualität und
Sexualmagie
2 - Der Dalai Lama
(Avalokiteshvara) und die Dämonin (Srinmo)
Die Fesselung der Erdgöttin Srinmo und die
Ursprungsgeschichte Tibets
Die alchemistische Aufspaltung des Weiblichen: Die
tibetischen Göttinnen Palden Lhamo und Tara
Die mythologischen Hintergründe des tibetisch
chinesischen Konflikts: Avalokiteshvara und Kuan Yin
Feminismus und tantrischer Buddhismus
Der XIV Dalai Lama und die Frauenfrage
3 - Die Grundlagen
der tibetischen Buddhokratie
Die Geschichte des buddhistischen Staatsgedankens
Der Dalai Lama und der buddhistische Staat sind eins
Scheinbekenntnisse des XIV Dalai Lamas zur westlichen
Demokratie
Der "Grosse Fünfte" - Absoluter Sonnenkönig
über Tibet
Die Vorgänger des V Dalai Lama
Die Nachfolger des "Grossen Fünften": der
XIII und XIV Dalai Lama
Inkarnation und Macht
Der "Grosse Fünfte" und das
Inkarnationssystem
Die sakrale Macht der tibetischen Könige und deren
Übertragung auf die Dalai Lamas
Der XIV Dalai Lama und die Inkarnationsfrage
Einführung der Inkarnationslehre in den Westen
Die verschiedenen Orden des tibetischen Buddhismus
Vereinigung der tibetisch buddhistischen Orden unter
die absoluten Vorherrschaft des XIV Dalai Lama
Die "Karmapa Affäre"
4 - Die soziale
Wirklichkeit im alten Tibet
Das westliche Tibetbild
Struktur der alttibetischen Gesellschaft
Das tibetische Strafrecht
Kommerz des Klerus
Die politische Intrige
Die neueren Entwicklungen im Geschichtsbild
5 - Buddhokratie und
Anarchie - ein Widerspruch oder eine Ergänzung?
Die Großzauberer (Maha Siddhas)
Der anarchistische Gründervater des tibetischen
Buddhismus: Padmasambhava
Von der Anarchie zur Ordensdisziplin: Die Tilopa Linie
Die eingeplante Gegenwelt zur Bürokratie des Klerus:
Heilige Narren
Ein anarchistischer Erotiker: Der VI Dalai Lama
Eine tantrische Geschichte Tibets
"Crazy Wisdom" und der Westen
6 - Der Königsmord
als Ursprungsmythos des Lamaismus und die rituelle Aufopferung Tibets
Das rituelle Königsopfer in der Geschichte Tibets und
der tibetische "Sündenbock"
Die Aktualität des Ritualmordes bei den Exiltibetern
Die rituelle Aufopferung Tibets
7 - Krieg der
Orakelgötter und die Shugden Affäre
Das tibetische Staatsorakel
Dorje Shugden - eine Lebensbedrohung für den XIV Dalai
Lama?
8 - Magie als ein
Mittel der Politik
Dämonenbeschwörung
"Voodoozauber"
Das La (bla)
Magische Superwaffen
Mandalapolitik
9 - Die Kriegsgötter
hinter der Friedensmaske
Die Aggressivität der tibetischen Schutzgötter
(Dharmapalas)
Gesar von Ling - der tibetische "Siegfried"
Die tibetischen Kriegerkönige und ihre klerikalen
Nachfolger
Die Dalai Lamas als höchste Kriegsherren
Die Geschichtsklitterung vom "friedlichen"
Tibeter
Ist der XIV Dalai Lama der "größte lebende
Friedensfürst"?
Die tibetische Guerilla und der CIA
Marschmusik und Terror
Politisches Kalkül und buddhistische Friedensbotschaft
"Buddha hat gelächelt": Der XIV Dalai Lama
und die indischen Atomversuche von 1998
10 - Vorreiter des
Shambhala Krieges: Die Mongolen
Dschingis Khan als Bodhisattva
Der mongolische Shambhala Mythos
Der blutige Rächerlama Dambijantsan
Der "Orden der buddhistischen Krieger"
Der XIV Dalai Lama und die Mongolei
11 - Der Shambhala
Mythos und die buddhokratische Eroberung des Westens
Der Shambhala Missionar Agvan Dorzhiev
Madame Blavatsky und der Shambhala Mythos
Nicholas Roerich und das Kalachakra Tantra
Der "Shambhala Krieger" Chögyum Trungpa
Andere westliche Shambhala Visionen
Der XIV Dalai Lama und der Shambhala Mythos
Negative Shambhala Visionen aus dem Westen
12 - Der Faschismus
und seine enge Beziehung zum buddhistischen Tantrismus
Der ehemaliger SS'ler Heinrich Harrer: Lehrer des XIV
Dalai Lama
Julius Evola: Der "tantrische" Berater
Benito Mussolinis
Miguel Serrano: "Freund" des Dalai Lama und
Chefideologe des "esoterischen Hitlerismus"
13 - Der
Weltuntergangsguru Shoko Asahara und der XIV Dalai Lama
Die Beziehungen Shoko Asaharas zum XIV Dalai Lama
Der inszenierte Shambhala Krieg
Das Ritualwesen der Sekte ist tantrisch- buddhistisch
Mord, Gewalt und Religion
Das japanische Armageddon
Religion und chemische Labors
Das Lied vom Sarin
14 - Chinas traditioneller
Anspruch auf den Weltenthron und seine metaphysische Konkurrenz mit Tibet
Mao Zedong: Die "Rote Sonne"
Mao Zedongs "Tantrismus"
Eine spirituelle Konkurrenz zwischen dem XIV Dalai
Lama und Mao Zedong?
Die nachmaoistische Ära in Tibet
Eine panasiatische Vision des Kalachakra Tantras?
Taiwan - ein Sprungbrett für den tibetischen
Buddhismus und den XIV Dalai Lama?
Gibt es ein chinesisches Interesse am Shambhala
Mythos?
15 - Die
buddhokratische Eroberung des Westens (Taktiken, Strategien, Ziele)
Die "Tibetlobby"
Die Manipulation der "Grünen"
Die Scheinwelt des interreligiösen Dialoges und der
Ökumene
Moderne Wissenschaft und tantrischer Buddhismus
Die Kosmogonie des Buddhismus und das postmoderne
Weltbild
Hollywood und tantrischer Buddhismus
16 - Konklusion
Das atavistische Muster des tibetischen Buddhismus
"Kampf der Kulturen": Der
fundamentalistische Beitrag des Lamaismus
Postscriptum:
Schöpferische Polarität jenseits des Tantrismus
POSTSCRIPTUM:
SCHÖPFERISCHE
POLARITÄT
JENSEITS DES
TANTRISMUS
So überraschend das nach
unserer kritischen Analyse des Vajrayana auch klingen mag, wir
möchten am Ende die Frage aufwerfen, ob nicht gerade der tantrische
Buddhismus in sich ein religiöses Urbild birgt, dessen Enthüllung, dessen
Verbreitung und dessen Erörterung ein großes transkulturelles Interesse
auslösen könnte. Wäre es nicht wertvoll, solche tantrischen Prinzipien wie
die "mystische Geschlechterliebe", die "Vereinigung des
männlichen mit dem weiblichen Prinzip", die unio mystica
zwischen Gott und Göttin als einen religiösen Entwurf zu diskutieren?
Der Tantrismus beruht in all
seinen Ausdrucksformen - wie wir zu Beginn unserer Studie gezeigt haben -
auf einer Vision von der Polarität des Seins. Er sieht in einer mystischen
Konjunktion der Pole, konkret in der mystischen Vereinigung der
Geschlechter das primäre Kultereignis des Erleuchtungsweges. Alle Phänomene
des Universums sind nach tantrischer Vorstellung durch Eros und Sexus
miteinander verbunden und unsere Erscheinungswelt gilt als das Wirkfeld dieser
beiden Grundkräfte (Tibet. Yab und Yum; chin. Yin und Yang).
Sie manifestieren sich als Polarität in der Natur ebenso wie in den Sphären
des Geistes. Die Liebe ist - nach tantrischer Sicht - die große
Lebenskraft, die durch den Kosmos pulsiert und zwar primär als die
doppelgeschlechtliche Liebe zwischen Gott und Göttin, zwischen Mann und
Frau. Ihre gegenseitige Zuneigung wirkt als das Schöpfungsprinzip.
"Es ist durch die Liebe
und angesichts der Liebe, dass sich die Welt entfaltet, durch die Liebe
findet sie ihre ursprüngliche Einheit und ihre ewige Nicht- Trennung
zurück." - auch das verkündet ein Satz des Vajrayana. (Faure,
56) Für einen Tantriker sind erotische und religiöse Liebe nicht getrennt. Sexualiät
und Mystik, Eros und Agape (spirituelle Liebe) bilden
keine sich ausschließende Widersprüche.
Wir wiederholen noch einmal die
schönen Worte, mit denen tantrische Texte die "Heilige Hochzeit"
zwischen Mann und Frau beschreiben: Im Yuganaddha (der mystischen
Vereinigung) gibt es "weder Zustimmung noch Ablehnung, weder Sein noch
Nicht-Sein, weder Vergessen noch Erinnern, weder Verhaftung noch
Nicht-Haftung, weder Ursache noch Wirkung, weder Hervorbringen noch
Hervorgebrachtes, weder Reinheit noch Unreinheit, weder Form noch
Formlosigkeit; es besteht allein in der Synthesis all dieser
Dualitäten". (Dasgupta, 1974, 114) In dieser Synthesis wird "das
Ego abgeschafft und die beiden polaren Gegensätze vereinen sich in einem
Zustand von warmer und vertrauter Verzückung." (Walker, 85)
An die Stelle des Kampfes der
Gegensätze (oder Geschlechter) ist jetzt die Kooperation der Pole getreten.
Körper und Geist, Eros und Transzendenz, Gefühl und Verstand, Sein (Samsara)
und Nicht-Sein (Nirwana) feiern Hochzeit. Alle Kriege und Kontroversen
zwischen Gut und Böse, Himmel und Hölle, Tag und Nacht, Traum und
Wahrnehmung, Freude und Leid, Lob und Verachtung werden im Yuganaddha
- so heißt es - pazifiziert und aufgehoben. Die Umarmung des männlichen
Buddhas mit dem weiblichen Buddha feiert Miranda Shaw als "ein Bildnis
der Einheit und der glückseligen Übereinstimmung zwischen den Geschlechtern
im Zustand des Gleichgewichts und der gegenseitigen Vereinigung. Dieses
Symbol bringt machtvoll die Ordnung ursprünglicher Ganzheit und Vollendung
zum Vorschein." (Shaw, 1994, 200)
Der göttliche Eros führt nicht
nur zur Erleuchtung und Befreiung sondern die mystische Geschlechterliebe
kann - auch das ist tantrische Anschauung - alle leidenden Wesen befreien.
Aus dem göttlichen Urpaar entsteht die Zeit in all ihren Ausdrucksformen.
Sonne und Mond und die "strahlenden Planetenpaare" ebenso wie die
fünf Elemente verdanken ihr Erscheinen dem kosmogonischen Eros. "Durch
die Vereinigung des männlichen mit dem weiblichen Sexualorgan (wird) die
Einheit im Eros hergestellt." - heißt es im Hevajra Tantra -
"Aus dem Kontakt in dieser erotischen Vereinigung, als der Qualität
der Härte, entsteht das Element Erde; Wasser kommt aus den Flüssigkeiten
des Samens; Feuer aus der Reibung beim Geschlechtsakt; Luft bildet sich aus
der Bewegung und das Raumelement aus der erotischen Freude." (Farrow,
134) Die Sprache, die Gefühle, die Sinne - alles hat seine Ursache in der
Liebe des Urpaares. "In der von Finsternis gereinigten Welt steht ein
Paar am Ende der Finsternis." - heißt es selbst im Kalachakra
Tantra. (Banerjee, 1959, 24)
Dennoch wird - und das haben
wir seitenlang nachgewiesen - dieses harmonische Urbild durch die
tantrischen Rituale zu spirituellen und profanen Machtzwecken einer
androzentrischen Mönchskaste mißbraucht. Wir ersparen uns, die
sexualmagische Ausbeutung durch den Vajrayana noch einmal zu
beschreiben, sondern wollen zum Schluss auf eine philosophische Frage, die
das Thema aufwirft, eingehen, nämlich auf das Verhältnis des EINEN (als dem
männlichen Prinzip) zum ANDEREN (als dem weiblichen Prinzip).
Das Thema des ANDEREN ist seit
Friedrich Hegel zu einem Königsthema des philosophischen Diskurses
geworden. Das absolut EINE oder der absolute Geist kann nichts ANDERES
neben sich dulden. Erst wenn das ANDERE völlig in das EINE integriert ist,
erst wenn es im EINEN "aufgehoben" wurde, ist der Weg des Geistes
vollendet. Dann ist die Natur (das ANDERE) zum Geist (das EINE) geworden.
So könnte man in knappen Worten einen Grundgedanken der hegelschen Philosophie
beschreiben.
In der Terminologie des Vajrayana
stellt der androgyne ADI BUDDHA das absolut EINE dar, das nichts ANDERES
(weibliches) außerhalb seiner selbst zuläßt. Das ANDERE (weibliche)
verliert unter der Herrschaft des EINEN (männlichen) seine Autonomie. Es
wird mit einem Wort vernichtet. Durch ein ANDERES (weibliches) würde das
absolute EINE des ADI BUDDHA radikal in Frage gestellt, sein Anspruch auf
Unendlichkeit, auf Kosmozentrizität, auf Allmacht und Göttlichkeit wäre
bedroht. "Alles ist EINES oder alles ist der ADI BUDDHA!" - ist
eine Grundmaxime des tantrischen Weges. Aus diesem Grunde versetzt das
ANDERE das EINE in Furcht und Schrecken. Der Buddhist Ken Wilber (ein
Propagandist des ADI BUDDHA Prinzips) zitiert in diesem Kontext die Upanishaden:
"Wo immer ANDERES ist, da ist Furcht." (Wilber, 1990, 174) - und
bekennt selbst: "Doch überall wo es ein ANDERES gibt, ist auch
Angst." (Wilber, 1990, 280)
Hinter dieser existentiellen
Angst vor dem ANDEREN verbirgt sich - wie schon angedeutet - eine prinzipielle
Geschlechterthematik. Diese wurde vor allem von französischen Feministinnen
aufgegriffen und theoretisch verarbeitet. Simone de Beauvoir sah in der
"Andersheit" (autruité) des Weiblichen noch eine höchst
problematische Fixation der Frau durch den androzentrischen Blick. Der Mann
wollte die Frau als das ANDERE sehen, um sie beherrschen zu können. Sie war
gezwungen ihre Identität über den Blick des Mannes zu definieren.
Nachfolgerinnen Beauvoirs dagegen, wie zum Beispiel die Feministin Luce
Irigaray, haben der "Geschlechterdifferenz" und AUTRUITÉ
(Andersheit) eine höchst positive Bedeutung gegeben und sie zum
Zentralthema ihrer femininen Philosophie gemacht. Die Andersheit wird hier
geradezu zu einer weiblichen Welt, die weder durch den männlichen Blick noch
durch die männlichen Vernunft zu fassen ist. Sie entzieht sich jeder
maskulinen Fixierung. Die weibliche Subjektivität ist der männlichen nicht
zugänglich.
Gerade die ANDERSHEIT macht es
den Frauen möglich, ihre Autonomie zu wahren. Sie entziehen sich dadurch
der Verobjektivierung durch den Mann (das männliche Subjekt) und entwickeln
ihre eigene Subjektivität (das weibliche Subjekt). Irigaray spricht sehr
klar aus, wie der Frau von bestehenden Religionen der Zugriff auf die
eigene Ichwerdung versperrt wird: "Sie muß immer für den Mann
verfügbar sein als dessen Transzendenz!" (zit. b. June Campbell, 155)
- das heißt als Sophia, Prajna, als "weiße
Jungfrau", als "Wissensdakini" (Inana Mudra). Sie ist
für das männliche Bewusstsein ohne eigene Subjektivität, eine leere
Leinwand (Shunyata), auf die der Mann seine Imaginationen
projiziert.
Die Autonomie des ANDEREN
braucht jedoch keineswegs als Trennung, Fragmentierung, Mangel oder als ein
Moment der Entfremdung erfahren zu werden. Sie kann genauso umgekehrt als
die Voraussetzung für die Vereinigung von zwei Subjekten, als gegenseitige
Ergänzung oder als Copula dienen. Männliches und Weibliches haben die
Möglichkeit, sich als Dualität (sich einander ausschließende Gegensätze =
Vernichtung des ANDEREN) wie als Polarität (sich einander ergänzende
Gegensätze = Begegnung mit dem ANDEREN) völlig unterschiedlich zueinander
zu verhalten. Es ist geradezu eine Gnade, dass es den Geschlechtern
grundsätzlich erlaubt ist, sich in Liebe zu begegnen, ohne auf ihre
Autonomie verzichten zu müssen.
Im buddhistischen Tantrismus
geht es jedoch nicht um eine solche Begegnung von Mann und Frau, sondern
allein um die Frage, wie kann der Yogi (als das männliche Prinzip des
EINEN) das ANDERE (das weibliche Prinzip) in sich integrieren und für sich
durch das Absaugen der Gynergie nützlich machen? Um das gleiche nur
mit umgekehrtem Vorzeichen geht es dem okkulten Feminismus: wie kann sich
die Yogini (hier als das weibliche Prinzip des EINEN) die Andronergie des
Mannes (hier als das ANDERE) zur Akkumulation von gynandrischer Macht
aneignen.
Die Aneignung des ANDEREN (der
Göttin) durch das EINE (den ADI BUDDHA) ist der philosophische Kerngedanke
des buddhistischen Tantrismus. Er ist damit ein Phänomen, welches in dieser
Allgemeinheit auch die westliche Kulturen und Religionen bestimmt:
"Das männlich Religiöse maskiert eine Aneignung." - schreibt Luce
Irigaray - "Diese unterbricht die Beziehung zum natürlichen Universum,
ihre Einfachheit wird pervertiert. Sicher, dieses Religiöse versinnbildlicht
ein von Männern organisiertes soziales Universum. Aber diese Organisation
ist auf einem Opfer gegründet: dem der Natur, dem des geschlechtlichen
Körpers, insbesondere dem der Frau. Es erzwingt ein von seinen natürlichen
Wurzeln und seiner Umwelt abgeschnittenes Spirituelles. Es kann daher die
Menschheit nicht zur Vollendung bringen. Spiritualisieren, Sozialisieren,
Kultivieren erfordert, daß man von dem, was ist, ausgeht. Das patriarchale
System tut dies nicht, weil es das, worauf es gegründet ist, auslöschen
will." (Irigaray, 1991, 33)
Die Lösung des
Mysterienrätsels, das uns der Tantrismus aufgibt, liegt auf der Hand. Es
kann nur um die Vereinigung der beiden Pole nicht um ihre gegenseitige
Beherrschung gehen. Der (männliche) Geist genügt nicht allein, um
"ganz" zu werden, sondern Natur und Geist, Gefühl und
Verstand, Logos und Eros, Frau und Mann, Gott und
Göttin, ein männlicher und ein weiblicher Buddha als zwei autonome
Wesen müssen mystische Hochzeit (als Yab und Yum; Yin
und Yang) feiern, als zwei Subjekte, die zu einem WIR verschmelzen.
Der ADI BUDDHA des Kalachakra Tantra dagegen ist ein göttliches
SUBJEKT (ein SUPER ICH), das versucht das ANDERE (die Göttin) zu
verschlingen. Erst wenn das EINE SUBJEKT mit einem ANDEREN SUBJEKT eine
Copula bildet, kann eine wirklich neue Dimension (im WIR) betreten werden:
Das große WIR, in dem beide Ichs, das männliche wie das weibliche, wirklich
"aufgehoben" werden, wirklich "bewahrt" und wirklich
"transzendiert" werden. Vielleicht ist dieses WIR das kosmische Geheimnis,
welches an den tiefsten Stelle der Tantras zu entdecken ist, und nicht der
ADI BUDDHA?
Denn im WIR verschmelzen alle
Polaritäten des Universums, das Subjektive und das Objektive, das Herrschen
und das Dienen, die Vereinigung und die Trennung. Die unio mystica
mit dem Partner beziehungsweise der Partnerin löst die individuelle und die
transpersonale Subjektivität (das humane Ego und das göttliche Ego) auf.
Beide Pole, der männliche wie der weibliche, erleben ihre geistige,
psychische und physische Einheit als Intersubjektivität, als Austausch, als
WIR. Sie verbinden sich zu einer höheren Dimension, ohne sich zu
vernichten. Das mystische WIR bildet deswegen eine umfassendere
Erlebnisqualität als das mystische EGO des ADI BUDDHA, das versucht, das ANDERE
(die Göttin) zu schlucken.
Würden sich Mann und Frau
selber als komisches Zentrum, als Gott und Göttin erfahren - wie es in den
tantrischen Texten zu lesen ist -, würden sie sich gemeinsam als eine religiöse
Instanz erleben, dann würde der androgyne Guru als der Übergott aus den
"Mysterien der Geschlechterliebe" verschwinden. Die Indologin Doniger
O'Flaherty beschreibt in einem Essay über tantrische Praktiken mehrere
Varianten der Androgynität und ergänzt diese - nicht ohne einen ironischen
Unterton - durch ein weiteres "androgynes" Modell, das im Grunde
gar keines ist: "Ein dritter psychologischer 'Androgyn'," - so
die Autorin - "weniger eng mit irgendeiner Doktrin verbunden, findet
sich nicht in einem einzigen Individuum sondern in zweien: dem Mann und der
Frau, welche sich in perfekter Liebe miteinander verbinden - Shakespeare's
Tier mit zwei Rücken. Dies ist das Bild der ekstatischen Vereinigung, eine
andere Metapher für die mystische Vereinigung mit der Gottheit. Dies ist
das romantische Ideal der vollendeten Vermischung, des einen mit der
anderen, sodaß jeder die Freude des/der anderen erfährt und nicht mehr
weiß, wem von beiden die Hand gehört, die einen zärtlich streichelt, oder
von wem die Haut ist, die gestreichelt wird. In diesem Zustand, erleben der
Mann und die Frau im 'tantrischen' Experiment des anderen Freude und
Schmerz. Dies ist der göttliche Hierogamos (die mystische Hochzeit)
und in seinen verschiedenen Manifestationen - als Yab und Yum,
Yin und Yang, Animus und Anima - ist es
sicherlich das am weitesten verbreitete 'androgyne' Konzept."
(O'Flaherty, 1982, 293)
Gemeinsam - so lehrt uns trotz
allem der Tantrismus - konzentrieren Mann und Frau in sich die Macht,
getrennt sind sie ohnmächtig. Das WIR bedeutet gleichermaßen Machtzuwachs
und Machtverzicht. Im WIR verdichten sich die beiden Urkräfte (männlich -
weiblich) des Seins. Insofern ist das WIR absolut, die Omnipotenz. Aber zur
gleichen Zeit begrenzt das WIR die Macht der Teile, sobald sie getrennt
auftreten oder für sich als Einzelgeschlecht (als androgyner Übergott oder
als gynandrische Übergöttin) den Kosmos beanspruchen. Insofern ist das WIR
in seinem Kern relativ. Es ist nur dann effektiv, wenn sich die zwei Pole
komplementär verhalten. Schon gar nicht kann das WIR, als das höchste
Prinzip, etwas ANDERES missbrauchen und zu seinen Zwecken manipulieren,
denn jedes ANDERE ist per definitionem ein autonomer Teil des WIR.
Politisch gesehen repräsentiert das WIR ein Grundprinzip der Demokratie. Es
überwindet jegliches Feindbilddenken und den Krieg. Die traditionellen
Dualismen von Oben und Unten, Weiß und Schwarz, Hell und Dunkel vereinigen
sich im WIR zu einer schöpferischen Polarität.
Das androgyne Prinzip des
buddhistischen Tantrismus führt - das haben wir sowohl aus der rituellen
Logik des Vajrayana als auch empirisch aus der Geschichte des
tantrischen Buddhismus (insbesondere des Lamaismus) nachweisen können -
unvermeidlich zu Menschenopfern und Kriegen. Am Ursprung jedes Krieges steht
ein Geschlechterkampf - dieser Satz aus der griechischen Mythologie gilt im
besonderen Maße auch für den Tantrismus, der das Weltgeschehen aus dem Eros
ableitet. Folgt daraus nicht durch einen Umkehrschluss, dass der Friede
zwischen den Geschlechtern den Frieden in der Welt hervorbringen kann?
Globale Verantwortung entsteht aus der gegenseitigen Anerkennung und dem
Respekt vor der Stellung des Partners als der anderen Hälfte des Ganzen.
Mitgefühl, Sensitivität für alles andere, Verständnis, Harmonie - alles hat
hier ihren Ursprung. Ludwig Klages sieht im kosmogonischen Eros zwischen
zwei Menschen eine umwälzende Macht, die die Kraft hat, selbst die
"Geschichte" aufzuheben: "Geschähe das Unerhörte indes auch
nur zwischen zweien aus Hunderten von Millionen, so wäre die Fluchmacht des
Geistes gebrochen, der entsetzliche Angsttraum der 'Weltgeschichte '
zerränne', und es 'blühte Erwachen in Strömen des Lichts'." (Klages,
198) Das Ende der Geschichte durch die Liebe von Mann und Frau, Gott und
Göttin - ein Gedanke, welche sich durchaus mit einer tantrischen
Philosophie vereinbaren ließe - wenn da nicht die ultimative männliche
Usurpation durch den Yogi ins Spiel käme.
Vielleicht - so wollen wir
etwas weiter spekulieren - könnte die mystische Geschlechterliebe das
Mysterium für eine universelle "Kultur des Eros" darstellen, die
sowohl auf sinnlichen als auch spirituellen Grundlagen aufbaut? Eine solche
Idee ist keineswegs neu. Ende der 60er Jahre hat der amerikanische
Philosoph Herbert Marcuse in seinem Buch Eros and Civilization einen
"erotischen" Kulturentwurf skizziert. Leider ist mittlerweile
sein - so würden wir heute sagen -"paradigmatischer" Ansatz, der
Ende der 60er in aller Munde war, völlig in Vergessenheit geraten. Zu den
fundamentalen Freuden der menschlichen Existenz gehört nach Marcuse
"die Teilung in Geschlechter, der Unterschied zwischen männlich und
weiblich, zwischen Penis und Vagina, zwischen Du und Ich, ja sogar zwischen
Mein und Dein, und sie sind höchst erfreuliche und befriedigende Teilungen,
oder sie können es sein; ihre Abschaffung wäre nicht nur ein Wahn, sondern
ein Alptraum - der Gipfel der Unterdrückung." (Marcuse,
239)
In den Tagen, in denen wir mit
der Endkorrektur unseres Manuskriptes beschäftigt waren, erschien in der Bunten,
der Illustrierten, die noch einige Wochen vorher den Dalai Lama als einen
Gott auf Erden gefeiert hatte, ein Artikel des Kultursoziologen Nicolaus
Sombart mit dem Titel "Sehnsucht nach dem göttlichen Paar".
Sombart drückt unsere eigenen Vorstellungen sehr präzise aus, so dass wir
ihn ausführlich zitieren wollen: "Warum erscheint das Projekt Mensch
im göttlichen Design als Doppelgestalt? Die Zweiheit steht sinnbildlich für
die Polarität der Welt - die Bipolarität, auf der die Dynamik allen
Weltgeschehens beruht. Yin und Yang. Scheinbar getrennt und
doch zusammengehörend, widersprüchlich und komplementär, antagonistisch,
aber auf Harmonie, Synthese und Symbiose angelegt. Erst in gegenseitiger
Durchdringung ergänzen sie sich und sind das Ganze. Das Weltmodell ist das ewig
nach Vereinigung strebende Paar. Das kosmische Paar steht zueinander in der
Wechselwirkung einer erotischen Spannung. Es ist ein Liebespaar. Das Elend
der Welt liegt in der Trennung, der Vereinzelung, der Vereinsamung der
zueinander gehörenden, zueinander strebenden Teile; die Wonne, das Glück
liegen in der Vereinigung der beiden Geschlechter, nicht zweier Seelen, das
genügt nicht, sondern zweier dazu ausgestatteter Körper - ein lustvoller
Vorgeschmack auf die Rückkehr ins Paradies." (Bunte, Nr. 46/98, 40)
Es ist jedoch erstaunlich, wie
wenig es in der menschlichen Kulturgeschichte der mystischen
Geschlechterliebe gelungen ist, sich als archetypisches Bild zu verankern.
Obwohl das Mysterium der Liebe zwischen Mann und Frau von Milliarden von
Menschen praktiziert und erlebt wurde und wird, obwohl die meisten Kulturen
männliche und weibliche Gottheiten kennen, ist der Unio Mystica der
Geschlechter die Anerkennung als Religion weitgehend verwehrt geblieben.
Dabei spricht unendlich viel dafür, dass die Harmonie und die Liebe
zwischen Mann und Frau (Gott und Göttin) das Gewicht eines universellen
Paradigmas erhält. Selektierte Einsichten und Bilder aus den Mysterien des
tantrischen Buddhismus dürften beim Herausbilden eines solchen Paradigmas
sehr nützlich sein.
Göttliche Paare, auch wenn ihre
religiöse Verehrung nicht zu den zentralen Mysterien zählen, lassen sich in
allen Kulturen entdecken. Auch in der vorbuddhistischen
Mythologie Tibets begegnen wir ihnen, wobei sich beide Geschlechter die
Herrschaft über die Welt gleichberechtigt teilen. Matthias Hermanns nennt Khen
pa, den Herrscher des Himmels, und Khon ma, die Erdmutter, und
zitiert folgenden Satz aus einem einheimischen Schöpfungsmythos der
Tibeter: "Zunächst sind Himmel und Erde wie Vater und Mutter." (Hermanns,
1965, 72) Bei den tibetischen Urkönigen kannte man einen Gott des Mannes (pho-lha)
und eine Göttin der Frau (mo-lha) Mehrere innerasiatische Mythen
sehen Sonne und Mond als gleichwertige Mächte an, wobei der Sonne die
männliche Rolle, dem Mond die weibliche zugestanden wird. (Bleichsteiner,
19) Licht und Dunkelheit gelten in einem Bon Mythos als das kosmische
Urpaar. (Paul, 49)
Im tantrischen Buddhismus ist
das bei den Nyingmapa Schule verehrte zentrale buddhistische Paar, Samantabhadra
und Samantabhadri, übersetzt - das "höchste männliche
Gute" und das "höchste weibliche Gute" eine solch
potentielle Urgestalt. Dieses Buddhapaar wird in einer Yab - Yum
Haltung dargestellt. Beide Partner sind nackt, das heißt rein und frei.
Keiner von den beiden trägt irgendwelche Symbole mit sich, die auf
irgendeine dahinter verborgene magisch-relgiöse Absicht hinwesen könnten. Samanthabadra
und Samanthabadri stehen - so könnte man ihre Nacktheit
interpretieren - jenseits der Symbolwelt und sind deswegen ein Bild der
polaren Reinheit, frei von Göttern, Mythen und Insignien. Nur ihre
Körperfarben mögen noch als eine Metapher gewertet werden. Samanthabadra
ist blau klar und offen wie der Himmel, Samanthabadri ist weiß wie
das Licht.
Würde man Visionen religiöser Paarverehrung
mit buddhistischer Terminologie beschreiben, so könnten aus einem
Urbuddhapaar die vier Buddhapaare der vier Richtungen hervorgehen, ohne
dass diese mystische Pentade von einem Tantra Meister als androgyner ADI
BUDDHA vereinnahmt werden könnte. In einer nepalesischen Tantra Schrift
werden dagegen der ADI BUDDHA ("höchstes Bewusstsein") und die
ADI PRAJNA ("höchste Weisheit") als der Urvater und die Urmutter
der Welt verehrt. (Hazra, 21) Alle weiblichen Wesen des Universums sind
nach diesem Text Ausstrahlungen der ADI PRAJNA alle männlichen die des ADI
BUDDHA.
|